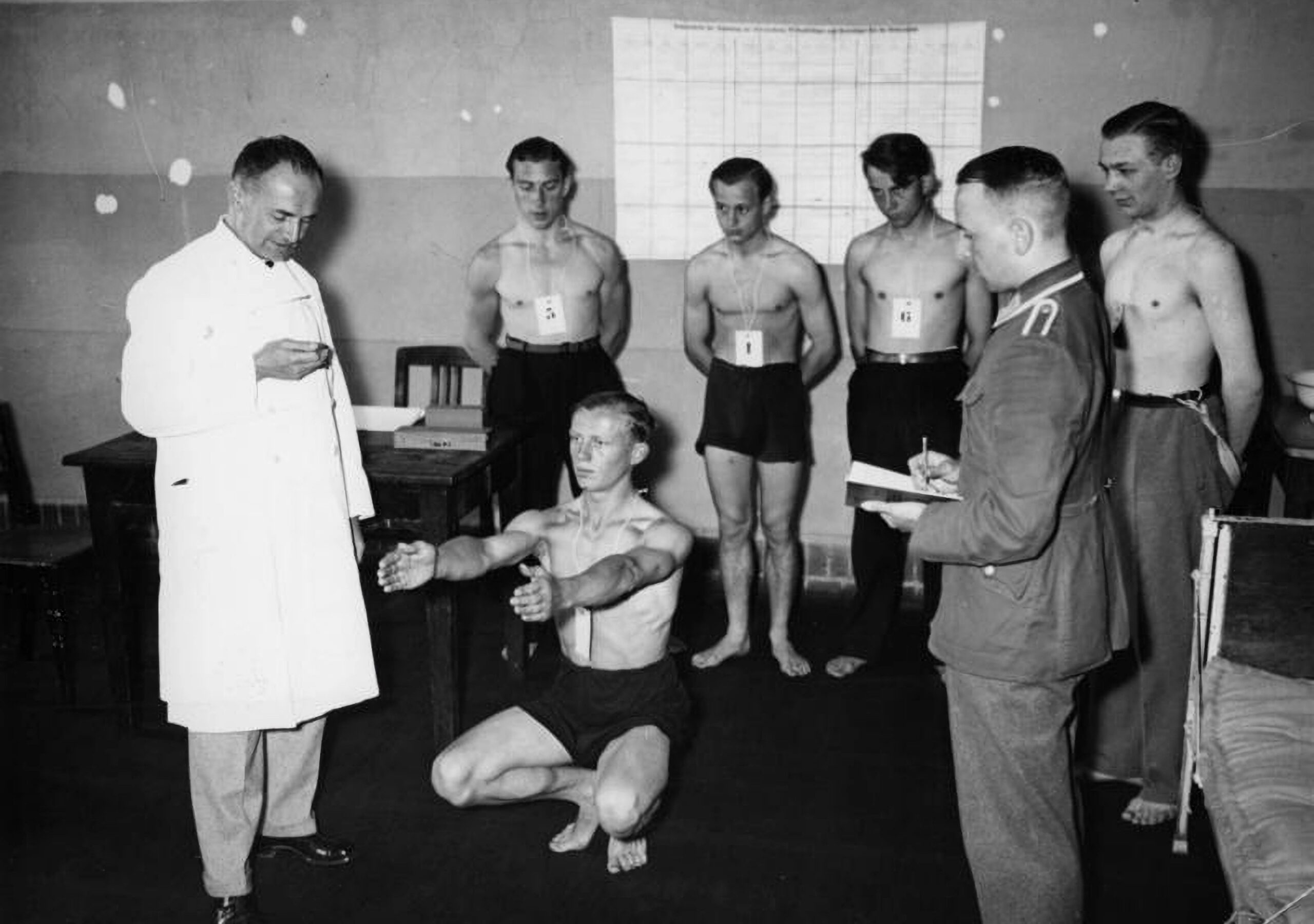Als Medienbeobachterin und Menschenrechtsaktivistin habe ich in den vergangenen zwei Jahren einen beispiellosen Diskursverlauf verfolgt. Was sich im österreichischen Umgang mit Gaza abspielt, ist mehr als eine außenpolitische Positionierung. Es ist ein Lehrstück darüber, wie historische Verantwortung instrumentalisiert, öffentlicher Diskurs verengt und demokratische Debattenkultur ausgehöhlt werden kann.
Der Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 war eine Zäsur. Die Reaktion in Österreich war eine des Entsetzens, zu Recht. Der damalige Bundeskanzler Karl Nehammer verkündete umgehend die Solidarität mit Israel, eine Position, die zunächst nachvollziehbar war. Doch was in den folgenden Wochen und Monaten geschah, offenbarte die fundamentale Engführung des österreichischen Diskurses.
Während international eine komplexe Debatte über Israels militärische Antwort entbrannte, während andere europäische Länder humanitäre Bedenken artikulierten oder auf die Einhaltung des Völkerrechts pochten, verharrte die österreichische Regierung in demonstrativer Loyalität. Die Formulierung, dass die Hamas die Verantwortung dafür trage, wenn es zivile Opfer im Gazastreifen gebe, wie Nehammer im Oktober 2023 erklärte, schien zum Leitmotiv zu werden, das jeden Raum für die Diskussion über Proportionalität, über die Mittel der Kriegsführung, über humanitäre Verpflichtungen verschließt.
Diese Position war nicht neu. Sie war das Ergebnis einer unter dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz etablierten Außenpolitik, die die besondere historische Verantwortung Österreichs zu einer Politik der nahezu bedingungslosen Unterstützung israelischer Regierungspolitik umgedeutet hatte. Was als moralische Verpflichtung begann, wurde zu einem Diskurskorsett, das kritische Fragen nicht mehr zuließ.
Ungleichbehandlung der Opfer
In den zwei Jahren seit dem 7. Oktober hat sich eine beunruhigende Hierarchisierung von Leid etabliert. Die mittlerweile über 60.000 dokumentierten Toten in Gaza, wobei Wissenschaftler*innen von weitaus höheren Zahlen ausgehen, werden diskursiv anders gewichtet als die Opfer des 7. Oktober. Ich hatte den Eindruck, dass das eine Leid als selbstverschuldet, als unvermeidbar, als von der Hamas instrumentalisiert dargestellt wird. Das andere, zu Recht, als unerträgliches Verbrechen.
Diese Ungleichbehandlung beobachte ich in der gesamten Berichterstattung. Wenn israelische Zivilist*innen sterben, scheint die Trauer ungeteilt, die Empörung universell, die Forderung nach Gerechtigkeit selbstverständlich. Wenn palästinensische Zivilist*innen sterben, Kinder in Schulen, Familien in Flüchtlingslagern, Journalist*innen bei ihrer Arbeit, dann folgen Relativierungen. Man liest, die Hamas benutze sie als menschliche Schutzschilde, die Zahlen seien nicht überprüfbar, Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung.
Im September 2024 strahlte das ORF-Weltjournal die Dokumentation „Gaza-Krieg – Hölle auf Erden“ aus. Die Reaktion war explosiv. Berichten zufolge warf die Israelitische Kultusgemeinde dem ORF vor, Hamas-Propaganda ungefiltert zu verbreiten und eine antisemitische Welle auszulösen. Es soll eine Beschwerde gefolgt sein, öffentliche Empörung, Diskussionen über Journalismusstandards. Die IKG soll die Löschung des Beitrags aus dem Archiv, unterstützt von rund 200 Privatpersonen aus der jüdischen Gemeinschaft gefordert haben.
Auf der anderen Seite steht eine Tatsache, die der ORF selbst im September 2025 recherchierte. Israelische Regierungspropaganda, die die humanitäre Krise in Gaza systematisch verharmlost, wird über millionenschwere Werbekampagnen auch in österreichischen Medien platziert. 105 Millionen Euro soll Berichten zufolge die staatliche israelische Werbeagentur 2024 ausgegeben haben, ein Anstieg von über 15 Prozent. Dazu käme ein Werbedeal mit Google über 38 Millionen Euro. Die Videos, die ein angeblich komfortables Leben in Gaza inszenieren, seien gezielt in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern ausgespielt worden, wo man das Gefühl habe, die Informationsschlacht sei noch nicht verloren.
Die Wahrheit ist, beide Seiten führen einen Informationskrieg. Doch die Fähigkeit der österreichischen Öffentlichkeit, diese Propaganda als solche zu erkennen und einzuordnen, ist durch die jahrelange Diskursverengung geschwächt. Man hat den Eindruck, dass der ORF, gesetzlich zu Objektivität und Ausgewogenheit verpflichtet, zwischen unvereinbaren Erwartungen navigieren muss. Eine kritische Dokumentation wird als Hamas-Propaganda attackiert, während die unkritische Wiedergabe israelischer Narrative als ausgewogen zu gelten scheint.
Angriffe auf Menschenrechte
Besonders aufschlussreich ist der Umgang mit Organisationen wie unserer, deren Kernaufgabe die Verteidigung universeller Menschenrechte ist. Amnesty International wurde bereits nach dem 7. Oktober 2023 und ganz besonders nach der Veröffentlichung des Genozid-Berichts im Dezember 2024 massiv angegriffen. Die Mechanismen waren immer dieselben. Aus einer methodisch fundierten Menschenrechtsanalyse wurde Hamas-Propaganda. Aus der Forderung nach Anwendung derselben völkerrechtlichen Standards, die überall gelten, wurde Einseitigkeit. Aus Menschenrechtsverteidigern wurden Verdächtige.
Der prominente ORF-Journalist Armin Wolf warf Amnesty im Oktober 2024 öffentlich vor, als PR-Plattform für die Hamas zu arbeiten. Dass eine der renommiertesten Menschenrechtsorganisationen der Welt derart delegitimiert werden kann, ohne dass dies breitere Empörung auslöst, ist bezeichnend für den Zustand des Diskurses.
Der damalige österreichische Außenminister Schallenberg meinte nach der Veröffentlichung des Genozidberichts von Amnesty International im Dezember 2024 zu Journalist*innen „Amnesty International hat sich schon mehrmals mit Vorverurteilungen Israels hervorgetan, das ist nicht überraschend. Wir tun aber gut daran, das dort entscheiden zu lassen, wo es hingehört: im Internationalen Gerichtshof und sonst nirgends. Die Stimme einer NGO tut hier nichts zur Sache“.
Auf internationaler Ebene sehen sich Human Rights Watch, Ärzte ohne Grenzen, UNICEF, alle Organisationen, die das Leid in Gaza dokumentieren, ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt. Der Mechanismus ist immer derselbe. Wer die humanitäre Katastrophe benennt, wird zur Partei erklärt. Die Shoa wird instrumentalisiert, um jede Kritik an israelischer Politik zu delegitimieren. Wer aufgrund österreichischer Geschichte für Menschenrechte in Gaza eintritt, wird als Geschichtsvergesser diskreditiert. Die Logik dahinter ist perfide. Aus unserer Vergangenheit folge bedingungslose Solidarität mit Israel, nicht etwa die Verpflichtung, Menschenrechtsverletzungen überall zu verhindern.
Umgang mit Haftbefehlen
Als im Dezember 2024 der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Benjamin Netanyahu und Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erließ, reagierte die österreichische Regierung mit diplomatischer Zurückhaltung. Während andere europäische Staaten ihre Verpflichtung zur Umsetzung der Haftbefehle betonten, hüllte sich Österreich in vornehmes Schweigen. Die historische Verantwortung, die sonst so prominent zitiert wird, galt in diesem Moment nicht.
Österreich hat nach 1945 einen langen, schmerzhaften Weg zurückgelegt. Von der Lebenslüge der Opferthese über Franz Vranitzkys historische Rede 1991, in der Österreich seine Mitverantwortung für die Verbrechen der Shoa anerkannte, bis zur heutigen besonderen Verantwortung. Doch diese Verantwortung wurde im Gaza-Diskurs pervertiert. Sie dient nicht mehr der Verhinderung künftiger Menschenrechtsverletzungen, sondern ihrer Rechtfertigung. Die Lehre aus Auschwitz war nie gemeint als Freibrief für Kriegsverbrechen, sondern als universelle Verpflichtung zur Wachsamkeit. Diese Verpflichtung endet nicht an den Grenzen Israels.
Protest – An der Wahlurne und auf der Straße
Bei der Nationalratswahl im September 2024 trat erstmals die Liste Gaza an, die Stimmen gegen den Völkermord. Mit 0,4 Prozent und 19.644 Stimmen blieb sie bedeutungslos für die Mandatsverteilung. Doch ihre bloße Existenz ist ein Symptom für die Verengung des politischen Spektrums. Die Liste vereinte ein heterogenes Spektrum. Jüdische Antizionistinnen , kandidierten neben palästinensischen Aktivistinnen und österreichischen Linken. Ihr Programm kombinierte Forderungen nach einem Ende der bedingungslosen Israel-Unterstützung mit Kritik an anti-muslimischem Rassismus in Österreich. Die etablierten Parteien ignorierten sie weitgehend, keine wollte sich mit der Thematik auch nur assoziieren.
Die knapp 20.000 Wähler repräsentieren jene Minderheit, die sich von keiner Parlamentspartei in ihrer Kritik an der österreichischen Gaza-Politik vertreten fühlte. Dass es für diese Position keinen Platz im etablierten Spektrum gibt, dass sie nur durch eine Protestliste artikuliert werden kann, spricht Bände über die Verengung des Diskurses. SPÖ, Grüne, NEOS, alle Parteien, die sich traditionell für Menschenrechte einsetzen, fanden in der Gaza-Frage keine eigenständige Position. Es hatte den Anschein, die Angst vor dem Antisemitismus-Vorwurf und dem „Shitstorm“ würden jede differenzierte Haltung lähmen.
Im August 2025 organisierte Amnesty International gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Kundgebung vor dem Parlament unter dem Motto Stoppt den Genozid in Gaza. Es sprachen die SPÖ-Abgeordnete Muna Duzdar und der frühere Grünen-Abgeordnete Georg Bürstmayr, unterstützt wurde die Kundgebung von KPÖ, Links und der Sozialistischen Jugend. Die Tatsache, dass eine solche Veranstaltung nur von Kleinparteien und einer aktiven Abgeordneten unterstützt wurde, während die im Parlament vertretenen Parteien fernblieben, zeigt die Isolation jener, die eine andere österreichische Politik fordern.
Besonders deutlich wird die österreichische Sonderposition im europäischen Vergleich. Während Spanien, Irland und Norwegen angesichts des Genozids in Gaza Sanktionen verhängten, verharrt Österreich in bedingungsloser Solidarität.
Die vergangenen zwei Jahre haben wiederkehrende Muster offenbart. Die berechtigte Sorge vor Antisemitismus wird missbraucht, um legitime Kritik zu unterbinden. Die notwendige Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Kritik an einer Regierungspolitik wird systematisch eingeebnet. Die bewusste Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus dient der Diskurskontrolle. Wer die Besatzungspolitik kritisiert, wer die Blockade Gazas seit 2007 thematisiert, wer die systematische Einschränkung palästinensischer Rechte benennt, läuft Gefahr, als antisemitisch gebrandmarkt zu werden.
Das humanitäre Völkerrecht wird nur dort eingefordert, wo es der eigenen Position dient. Die differenzierte Bewertung von Kriegsverbrechen, je nachdem, wer sie begeht, höhlt die Glaubwürdigkeit des gesamten internationalen Rechtssystems aus. Wenn Russland in der Ukraine Zivilist*innen bombardiert, ist der Aufschrei berechtigt und laut. Wenn Israel in Gaza Krankenhäuser zerstört, Flüchtlingslager bombardiert, die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln blockiert, dann folgen Erklärungen über militärische Notwendigkeit und Hamas-Taktiken.
Demokratische Streitkultur leidet
Es scheint als ob Journalist*innen, die differenziert berichten wollen, zwischen die Fronten geraten. Einerseits der Vorwurf der Hamas-Nähe, wenn sie palästinensisches Leid thematisieren. Andererseits der Vorwurf der Einseitigkeit, wenn sie israelische Regierungspositionen kritisch hinterfragen. Der sichere Weg scheint das Schweigen oder die Reproduktion von Regierungsnarrativen. Man gewinnt den Eindruck, die großen österreichischen Tageszeitungen, Der Standard, Die Presse, der Kurier, würden sich in einem engen Korridor bewegen. Ich sehe nur selten Kommentare, die über vorsichtige Kritik an beiden Seiten hinausgehen. Die Analyse israelischer Siedlungspolitik, der Blockade Gazas, der systematischen Einschränkung palästinensischer Rechte scheint keinen Platz zu haben.
Die Streitkultur der Demokratie leidet massiv. Eine Demokratie lebt von der Möglichkeit, unterschiedliche Positionen zu artikulieren, ohne existenziell bedroht zu werden. Diese Möglichkeit ist in der Gaza-Frage kaum noch gegeben. Wer vom Mainstream abweicht, wird marginalisiert, angegriffen oder zum Schweigen gebracht. Das ist keine Kleinigkeit, es ist der schleichende Tod des demokratischen Diskurses.
Das Vertrauen in Institutionen schwindet. Wenn Menschenrechtsorganisationen schlecht gemacht werden werden, Journalist*innen unter Druck gesetzt und kritische Stimmen marginalisiert, verlieren die Institutionen, die eigentlich demokratischen Diskurs ermöglichen sollen, ihre Glaubwürdigkeit. Der ORF, eigentlich zur Objektivität verpflichtet, wird von beiden Seiten attackiert und findet keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Die Politik, die eigentlich unterschiedliche Positionen ausbalancieren sollte, hat sich auf eine Seite geschlagen und verteidigt diese Position gegen alle Evidenz.
Und dennoch gibt es sie, die Menschen und Organisationen, die trotz massivem Druck weitermachen. Amnesty International dokumentiert weiter. NGOs wie Ärzte ohne Grenzen berichten vom Grauen in Gaza, trotz des Vorwurfs der Einseitigkeit. Ich habe den Eindruck, dass einzelne Journalist*innen differenziert recherchieren, trotz des Karriererisikos und Wissenschaftler*innen die Situation nüchtern analysieren, trotz akademischer Isolation.
Ehrlichkeit über die eigene Position
Was jetzt notwendig wäre, ist Ehrlichkeit über die eigene Position. Österreich müsste anerkennen, dass seine Politik nicht neutral ist, nicht ausgewogen, nicht dem Völkerrecht verpflichtet, sondern einseitig pro-israelisch. Erst wenn diese Realität benannt wird, kann darüber debattiert werden. Es bräuchte eine Entpolitisierung der Menschenrechte. Menschenrechtsorganisationen müssten geschützt werden, nicht bekämpft. Ihre Arbeit ist unbequem, das ist ihre Funktion in einer Demokratie.
Es geht nicht nur um Israel oder Palästina. Es geht auch um uns selbst. Um die Frage, welche Gesellschaft wir sein wollen. Eine, die wegschaut, wenn es unbequem wird? Die Menschenrechte instrumentalisiert, statt sie zu verteidigen? Die historische Verantwortung als Ausrede nutzt statt als Verpflichtung? Oder eine Gesellschaft, die den Mut aufbringt, komplexe Wahrheiten auszuhalten. Die Empathie nicht rationiert, sondern ausweitet. Die versteht, dass echte Solidarität mit Israel nicht bedeutet, zu schweigen, wenn Unrecht geschieht, sondern gerade dann zu sprechen.
Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, wir sind weit von dieser Gesellschaft entfernt. Der Diskurs ist vergiftet, die Fronten verhärtet, die Möglichkeit differenzierter Debatte fast verschwunden. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende geschrieben. Noch nicht. Solange es Menschen gibt, die sich nicht einschüchtern lassen, solange es Organisationen gibt, die weiter dokumentieren und anklagen, solange es den Willen gibt, die Augen nicht zu verschließen vor dem Leid, das im Namen einer historischen Verantwortung hingenommen wird, ist nicht alles verloren.
Die Frage ist nur, ob diese Stimmen gehört werden, bevor es zu spät ist. Ob die österreichische Gesellschaft die Kraft findet, sich aus dem selbstgewählten Diskursgefängnis zu befreien. Ob die historische Verantwortung, auf die man sich so gerne beruft, endlich ernst genommen wird in ihrer universellen Dimension. Die Antwort auf diese Fragen wird nicht nur über das Verhältnis Österreichs zu Israel und Palästina entscheiden. Sie wird entscheiden, was für eine Demokratie wir sind und sein wollen.
Ein Beitrag von Shoura Zehetner-Hashemi, Juristin und Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich