Trotz über Jahre hinweg gestreuter Spekulationen war es am Ende doch eine Überraschung, ein kleiner Coup sogar. Und so durchbrach am Mittag des 13. Oktober unter dem Jubel der versammelten Weltpresse für Sekunden ein Schmunzeln die demonstrativ gestrenge Miene von Sara Danius, Literaturwissenschaftlerin und ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, als sie neu ansetzte, um die Entscheidung der Jury zu begründen: Bob Dylan werde für seine poetischen Neuschöpfungen innerhalb der großen amerikanischen Songtradition der Nobelpreis für Literatur verliehen.
Der programmatische Charakter der Wahl war damit schon benannt. Denn es ist natürlich ein Signal, in Zeiten eines Donald Trump den populärsten amerikanischen Songwriter, eine Symbolfigur des progressiven und antirassistischen Aufbruchs der 1960er Jahre, ins Pantheon der literarischen Hochkultur zu heben. Nicht nur waren amerikanische Autoren viele Jahre leer ausgegangen, was der ehemalige Sprecher der Akademie, Horace Engdahl, 2008 damit begründete, die US-Literatur sei einfach »zu isoliert, zu insular«. Auch die viel diskutierte Erweiterung des Literaturbegriffs, die sich mit der Ehrung eines Rockmusikers verbindet, bildet lediglich einen Teilaspekt der Bedeutung, die dieser Entscheidung zukommt. Wichtiger noch ist: In wohl keinem anderen Werk seiner Zeit erkennen sich bis heute so viele Menschen wieder. Bob Dylan ist, quer zu Klassen- und Milieugrenzen, zu Generationen, politischen Weltanschauungen und ethnisch konstruierten Identitäten, ein Lebensbegleiter für Millionen geworden. Und natürlich ist er unauslöschlich verbunden mit der Geschichte der Jugendrevolte und der Bürgerrechtsbewegung, also zentralen Ausgangspunkten der Krise und Auflösung des sozial regulierten Kapitalismus der Nachkriegsära, dessen globales Zentrum die USA waren. Es lohnt sich, im Angesicht der autoritär-nationalistischen Wende kurz inne zu halten und diesem Erbe eines freiheitlichen und humanen Amerika – das sich spätestens mit der Kampagne um Bernie Sanders auch politisch zurückgemeldet hat, derzeit aber mit dem Rücken zur Wand steht – nachzuspüren. Denn von Dylan und seiner ungeheuren Wirkung in der Welt kann auch eine Linke viel lernen, die zwischen Ratlosigkeit, Wut und Verzweiflung changiert und der es bisher nicht gelingen will, eine breitenwirksame und inspirierende Erzählung zu entwickeln.i
Populare Traditionsbindung und Avantgarde
Die in den Feuilletons vornehmlich diskutierte Frage, ob Dylans Schaffen denn überhaupt Literatur sei, ist dagegen so müßig wie bezeichnend.ii Müßig, weil die poetische Qualität seines gewaltigen Oeuvres von so vielen Koryphäen der Literaturwissenschaft in akribischer Kleinstarbeit herausgearbeitet worden ist, dass manch leidenschaftlicher Dylan-Fan nur noch mit den Augen rollt, wenn wieder einmal ein hoch gelehrter Band zu den verschlungenen Bedeutungsgeflechten seiner Texte erscheint. Tatsächlich läuft eine allein auf die Lyrics fixierte Betrachtung, wie sie auch in der Bundesrepublik intensiv betrieben wurde, um Dylans Status als legitimer Künstler von Rang zu untermauern, stets Gefahr, den originären Charakter seiner Performancekunst zu verfehlen. Dylans einmalige Position in der Musikwelt gründet sich nämlich auf etwas, das dem expliziten Sinngehalt der Sprache noch vorgelagert ist: Der überragenden Qualität seiner Songs, deren harmonische Arrangements und Melodien immer einfach gehalten sind, die in ihrer Prägnanz und Vielschichtigkeit aber einen weiten Raum für unterschiedliche Interpretationen und Hörweisen eröffnen. Der Haupteinwand gegen die Ehrung ist daher auch der Hinweis, dass sich die ganze Kraft der Texte erst in ihrer Symbiose mit der Musik erschließt. Das allerdings ist ein eigentümlicher Einwand. Mit ihm spricht ein Teil des literarischen Establishments entwaffnend offen seinen puristischen und seltsam aus der Zeit gefallenen Dünkel aus: Dort, wo Sprache sinnlich vorgetragen wird, wo sie zu Bewegung und Interaktion einlädt, wo sie – auch jenseits der kleinen Zirkel der Kultureliten – buchstäblich durch den Alltag und die Körper der Menschen flutet, da soll sie keinen literarischen Wert mehr haben?
Ein solch steriler Literaturbegriff bemäntelt nur notdürftig das dahinterstehende Ressentiment gegenüber der Populärkultur. Denn natürlich steht dieser Preis nicht nur oder in erster Linie für eine Rückbesinnung auf die früh-antiken und mittelalterlichen Ursprünge der Literatur, in denen Text, Musik und mündliche Überlieferung oft ebenfalls eine Einheit bildeten.iii Es ist vor allem auch eine stellvertretende Auszeichnung der künstlerischen Leistungen der breiten Entwicklungslinie der Folk- und Rockmusik, ja mehr noch: der Popkultur insgesamt, deren maßgebliche ProtagonistInnen Dylan, über alle Genregrenzen hinweg, heute als eine zentrale Gründungsfigur anerkennen und häufig verehren.iv Man kann der Jury zu diesem Schritt, der die politisch fatale und schon lange überholte Unterscheidung zwischen »Hoch- und Massenkultur« in aller Deutlichkeit zurückweist, nur gratulieren.v Fast möchte man, um die Literaturkritik endgültig zu überfordern, noch die Empfehlung hinzufügen, in Zukunft auch mal einen Rapper auszuzeichnen. Schließlich dürfte Sprachkunst kaum irgendwo dem Zeitgeschehen und dem Leben gerade der unteren Klassenfraktionen so nahe sein, wie in der basslastigen Poesie der Straße.
Bei allen ihm eigenen Versteckspielen hat auch Dylan selbst nie Zweifel daran gelassen, dass er sich ganz in der Tradition der amerikanischen Volks- und Unterhaltungskulturen sieht: Ein »song and dance man«vi eben, ein Wiedergänger der seltsamen Maskenkünstler und fahrenden Gaukler, die seit der Jahrhundertwende die Jahrmärkte und Wanderzirkusse bevölkerten, um den Alltag der einfachen Leute mit ein wenig Budenzauber aufzuhellen oder gesellschaftliche Missstände anzuklagen.vii Die Verbindung mit den popularen Kulturen, ihrer plastischen Direktheit, auch ihren Klischees und Grobheiten, nie abreißen zu lassen, sie aber zugleich mit einer intellektuell anspruchsvollen Selbstreflexion und einer virtuosen Rezeption abendländischer Kunstgeschichte zu verbinden: Das macht den sozial fortschrittlichen Charakter von Dylans Werk aus. Es erfüllt in herausragender Weise eine Grundforderung, die Antonio Gramsci an eine »neue Literatur« stellte: »[…] sie muß bestrebt sein, schon Vorhandenes auszuarbeiten, polemisch oder auf andere Weise, darauf kommt es nicht an; worauf es ankommt, ist, daß sie ihre Wurzeln schlägt im Humus der Volkskultur, so wie sie ist, mit ihren Vorlieben, ihren Bestrebungen usw., mit ihrer moralischen und intellektuellen Welt, auch wenn diese rückständig und konventionell ist.«viii
Das emphatische Einlassen auf das soziale Unten und Außen bildet zweifellos eines der wichtigsten Grundmotive Dylans. Er ist, aufgewachsen in einer konventionellen jüdischen Familie der Mittelschicht, ein Kind der Vor-68er-Generation, die in den USA vor allem durch die Allianz mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und die Aneignung der im Folk und Blues tradierten Erinnerung an die sozialen Kämpfe der Zeit des »New Deal« eine deutlich intensivere Begegnung mit den Emanzipationsbewegungen der Arbeiterklassen erlebte als die späteren Kohorten der studentischen Alternativkulturen. Dylan verband die Thematisierung der Lebensverhältnisse, Leiden und Sehnsüchte, die diesen epochalen Bewegungen zugrunde lagen, mit einer eklektizistischen und sehr persönlichen Rezeption avantgardistischer Strömungen der Literatur. Das galt zunächst vor allem für die jazzaffine Beatkultur, die sich in existenzialistischem Gestus mit den Landstreichern und Wahnsinnigen identifiziert und das emotionale (vor allem männliche) Innenleben erkundet hatte – und die weniger eine literarische Schule, als eine gegen den Konformismus der Nachkriegsjahre gerichtete Lebenshaltung sein wollte. Mit der Blues- und Rockmusik griff Dylan zudem den lustvollen Sog der Rhythmen auf, den die bürgerliche Hochkultur, aber auch die respektable Mittelschicht bis dato als Ausdruck von hedonistischem Kulturverfall verurteilt und regelrecht gefürchtet hatte. Das Glück, diesen prüden Ballast endlich abzuwerfen, die eigene körperliche Expressivität zu entdecken, überhaupt: das Leben in vollen Zügen zu genießen – all das wurde 1965 plötzlich auf ein sprachliches Artikulationsniveau gehoben, das für den Rock’n’Roll der 1950er Jahre und auch noch für die erste Welle der »british invasion« (Beatles, Rolling Stones etc.) undenkbar gewesen war. Schon vor dem Höhepunkt der Revolte und verstärkt ab 1967 wandte Dylan sich schließlich mit großer Inbrunst auch dem konservativen Herzland der USA zu, erschloss jenen weiten musikalischen Horizont, der heute unter dem Stichwort »Americana« firmiert. In ihm treffen klassische Narrative des kapitalistischen Zeitalters – die Freiheit und Einsamkeit der Highways, die romantische Liebe und die Suche nach Arbeit – auf die Melancholie und die persönlichen Verwerfungen, die sich infolge der Polarisierungs- und Zerfallsprozesse im Nachgang der Niederlagen der Neuen Linken und der sozialdemokratischen Reformpolitiken (Johnsons »Great Society«) einstellen.
Ausgezeichnet wird also ein Werk, das zutiefst durchdrungen ist von dem Willen, die vielfältigen Erfahrungen all der Menschen zu Gehör zu bringen, die nicht zu den Begünstigten der Fortschrittsmaschine zählen: Jener, deren Stimme nicht gehört und deren Würde oft mit Füßen getreten wird, die sich womöglich auch in Borniertheit und Aggression verlieren, weil sie nie eine Chance bekamen, sich den kulturellen Reichtum der Moderne anzueignen. Über alle Verwandlungen, Triumphe und Abstürze hinweg, blieb die Feier einer Empathie, die Klassenschranken, politische und kulturelle Lagerbildungen sprengt, das Leitmotiv Bob Dylans. Dieser radikal-humanistische Anspruch ist heute, wo die Zäune nicht nur zwischen Staaten und Klassen, sondern auch in den Köpfen in erschreckendem Tempo wieder hochgezogen werden, aktueller denn je.
Distanz zur „political world“ und historische Grabungsarbeiten
Für die politische Linke war die so umfassend gestellte Frage nach der subjektiven Seite der sozialen Krisen – dieses entgrenzte how does it feel? – allerdings von Beginn an unbequem. Denn diese Frage zwingt zum Perspektivwechsel, zur Überprüfung aller Gewissheiten, aller Feindbilder und Unwahrhaftigkeiten. Nicht zufällig überwarf sich Dylan schon früh mit Akteuren der »political world«, wies die von links (u.a. von seiner damaligen Förderin und Geliebten Joan Baez) an ihn gerichtete Forderung, Sprachrohr der Bewegung zu sein, als Instrumentalisierung der Kunst vehement zurück.
Das zeigte sich exemplarisch bereits 1964, als Dylan seinen ersten großen Preis, den Tom-Paine-Award der Bürgerrechtsorganisation Emergency Civil Liberties Committee (ECLC), verliehen bekam. Die Dankesrede geriet zum Fiasko. Der hoch nervöse und offensichtlich angetrunkene Sänger, der zu diesem Zeitpunkt als Repräsentant, mehr noch: als Prophet der Bürgerrechts- und Jugendbewegung gefeiert wurde, griff nicht nur auf irritierende Weise die zu einer Spendengala versammelte Garde der älteren, inzwischen wohlsituierten Linken an (»sie haben überhaupt keine Haare auf dem Kopf, das macht mich ganz krank«). Nach einer Kritik an der Einordnung seiner Songs in ein politisches Links-Rechts-Schema, provozierte er auch mit der Aussage, er könne sich in den mutmaßlichen Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald hineinversetzen (»ich habe Dinge, die er gefühlt hat, in mir gesehen«). Die Empörung war groß. Schließlich hatte der Mord das linksliberale Amerika ins Mark getroffen. Trotz seiner zögerlichen und keineswegs durchgängig fortschrittlichen Politik galt Kennedy als Personifizierung des Aufbruchs. Dylans Freund und Biograf Robert Shelton beschrieb das Attentat später als einen auch für den jungen Folksänger einschneidenden Augenblick der Verzweiflung über die soziale und politische Entwicklung. So seltsam irrlichternd der Auftritt Dylans damals wirkte, nichts charakterisiert seine künstlerische und ethische Grundhaltung besser als diese eigenwillige Wendung: Ein Ereignis, das Rachegelüste wecken könnte, wird bewältigt, indem nach dem Erleben des Anderen, des Täters, gefragt wird, und mehr noch: indem nach Spuren seines Hasses im eigenen Selbst gesucht wird.
Es war diese emotionale Selbstbefragung, diese existenzielle Öffnung der Sinne und der sozialen Phantasie, die die Konfrontation mit Dylans Lieder zu einem kollektiven und zugleich höchst persönlichen Schlüsselerlebnis nicht nur für junge Menschen machte (und bis heute macht). Dylan lieh seine Stimme mal einer Mutter, die von den psychosozialen Folgen der Arbeitslosigkeit berichtete, mal einem alternden Säufer, oft auch einem Liebeskranken – und forderte dazu auf, sich in ihnen wiederzuerkennen. Er linderte den Schmerz, indem er ihn als etwas in dieser – noch immer nur oberflächlich zivilisierten – Welt Universelles fühlbar machte. Und er gab vermeintlich Unsagbarem einen Ausdruck, was viele als kathartisch erlebten. Das war (abgesehen vom konsequenten Anti-Rassismus) nur in relativ wenigen Fällen mit klaren politischen Botschaften verknüpft und schon gar nicht propagierte es einen voluntaristischen Veränderungsoptimismus. Dylans Kunst bewegt auf subtilere Weise. Sie verwebt intimste Empfindungen mit der Ausleuchtung des Fremden, der Wiederaneignung des Verdrängten, wozu immer auch die ästhetischen Verfremdungseffekte, vor allem der eigenwillige und bis heute polarisierende Einsatz der Stimme, gehören.ix
Was sich in Dylans Arbeit zeigt, ist, verallgemeinert gesprochen, die künstlerische Suche nach einer höheren Stufe der Vergesellschaftung von Gefühlen und Sinnlichkeit, jenseits der Schranken von Kleinfamilie und Warenästhetik. Diese sozial reflexive Subjektivität, die in den 1960er und 1970er Jahren, am bisherigen Höhe- und Umschlagspunkt der Zivilisierung der bürgerlichen Gesellschaft, relativ breit erprobt wurde und die ihre performativen Techniken und Projektionsflächen nicht zuletzt in der Popkultur findet, lässt tradierte Identitätsvorstellungen hinter sich. Sie will immer im Werden begriffen sein, sich immer neu erfinden, ohne zu vergessen – ein utopisch aufgeladenes, aber doch an den Alltag und die in ihm sedimentierte Zeit zurückgebundenes Projekt.
Geschichte wird immer auch gemacht, indem Geschichten erzählt werden, indem die Vergangenheit neu angeeignet wird. Erst in der langen Frist erschließen sich auf diese Weise soziale und persönliche Entwicklungen und mögliche Perspektiven der Emanzipation. Der rastlose Innovator und Gegenwartsdiagnostiker Dylan war denn auch von Anfang an vor allem ein singender Historiker und Archäologe. Er vergrub sich, gerade in den kulturrevolutionären 1960er Jahren, in Archiven und eignete sich mit seinen Kollegen von The Band die dort gefundenen Lieder und Mythen wieder und wieder an, um so dem kollektiven Gedächtnis neues Leben einzuhauchen. Diese Aufarbeitung der Geschichte veränderte die Erfahrung des Hier und Jetzt – mit praktischen, also auf zukünftiges Handeln gerichteten Folgen.
Abbrüche, Vorahnungen und Neuanfänge
Nach all dem möchte man Axel Honneth zustimmen, wenn er in einem bewegten Kommentar zur Entscheidung der schwedischen Jury schreibt, dass Dylan, der »Walt Whitman unserer Tage«, uns vom »Bewusstsein des Alleinseins« singt, »aber ohne die bedrückende Empfindung, damit allein zu sein«, davon, »wie wir uns ohne Verrat unseres vielstimmigen Ichs als Glieder einer umfassenden Bewegung begreifen können, die sich den Verfehlungen dieser Welt widersetzt«.x
Aber in dieser Sicht wird etwas geglättet, das in sich zerrissener war und ist. Denn ob es Dylan, wie Honneth meint, wirklich gelang, »die Kluft zwischen dem Existenzialismus der fünfziger Jahre und dem Geist der Revolte der siebziger Jahre« zu schließen und »diese widerstreitenden Gefühlsmomente in seinen Liedern zu versöhnen«, ja mehr noch: ob er dies überhaupt je angestrebt und für möglich gehalten hat, kann mit guten Gründen bezweifelt werden. Dylan »versöhnt« Widersprüche nicht. Er erkennt sie vielmehr als gegebene Realität an und gibt ihnen eine plastische Gestalt. Seine Geschichte bleibt, wie die Geschichte der Kulturrevolte und der Neuen Linken insgesamt, auch eine tragische: voller Spaltungsprozesse, Sackgassen und Abgründe. Gerade die Mitte der 1960er Jahre, die mit Dylans Übergang zur Rockmusik und einer surrealistischen Poesie in den Augen vieler den Zenit seines künstlerischen Schaffens und seiner historischen Breitenwirkung markieren, erlebte der Mensch Bob Dylan als eine Zeit schwerer Desillusionierungen und Verletzungen – daran lassen die biografischen Zeugnisse und auch die Lyrics selbst wenig Zweifel (man denke etwa an Songs wie It‘s All Right, Ma oder Desolation Row). Dylan selbst und ihm nahestehende Menschen sprachen damals offen von Todessehnsucht.xi
Das hatte persönliche und historische Gründe, beides lässt sich kaum trennen. Die verwickelte, aber doch sehr enge Koppelung zwischen öffentlichen und intimen Kämpfen – vor allem im Verhältnis der Geschlechter – wird von Dylan schonungslos ausgeleuchtet. Während die antirassistische Bewegung angesichts interner Konflikte, wachsender Militanz und Repression in die Defensive geriet, während der studentische Protest zunehmend in eine psychedelische Aussteigerkultur und irreale Revolutionsphantasien abdriftete und die Folkbewegung sich – nicht zuletzt entlang der Kontroversen um Dylans Elektrifizierung und seine Abkehr vom »Topical Song« – überwarf und auflöste, zerbrachen im Leben des Mittzwanzigers wichtige Beziehungen. Der Wechsel ins große Popbusiness und die sich überschlagende, oft hochgradig verzerrende Presseberichterstattung taten ihr Übriges und setzten dem sensiblen Künstler so massiv zu, dass seine gefürchtete Scharfsinnigkeit immer häufiger in zynische Überheblichkeit umschlug.xii
Auch Dylans wechselnde künstlerische Inkarnationen und Schaffensperioden grenzten sich in den ersten Jahrzehnten polemisch voneinander ab – so sehr, dass der Streit unter seinen Fans, die ihn in Teilen des Verrats bezichtigten, mitunter handgreiflich wurde. 1966, nach einem Motoradunfall, zog er sich für rund acht Jahre nahezu völlig aus der Öffentlichkeit zurück, lebte ein zurückgezogenes Familienleben auf dem Land und wandte sich mit dem »alten, unheimlichen Amerika« auch der Religion verstärkt zu – bis hin zu der für viele Fans verstörenden (wenn auch vorübergehenden) »Wiedergeburt« als evangelikaler Christ auf dem Höhepunkt der neokonservativen Gegenrevolution 1979. Was in den 1980er und 1990er Jahren folgte, war eine lange Kette von künstlerischen Irrfahrten, weit abseits der neuen politischen und kulturellen Bewegungen. Es gibt, wie bei vielen RockmusikerInnen seiner Generation, in dieser Zeit starke Hinweise auf wiederkehrende Depressionen. Ab 1997 kommt es zwar zu einem spektakulären Comeback. Aber auch das Alterswerk, das die eigene, wie die Geschichte der amerikanischen Populärmusik insgesamt in souveräner Geste integriert und neu zu Gehör bringt, ist äußerst dunkel gefärbt. Signifikante Songs wie Not Dark Yet oder Things Have Changed mögen das illustrieren.
Man sollte also nicht den Fehler der nostalgischen Idealisierung machen. Die Fallhöhe war hoch, gerade für Dylan, der, wie auch andere KünstlerInnen in den 1960er Jahren, ein feines Gespür für die Möglichkeit einer emotional reicheren Existenzweise entwickelt hatte und diese Erfahrung dem Menschheitsgedächtnis einschrieb. Die Ansprüche der Kunst, die sich mit der historischen Entwicklung des Bürgertums als utopische Gegenwelt und Sphäre der Distinktion verselbstständigt hatte, sollten in ein ganzheitlicheres Leben zurückgeholt werden. Aber das kann bestenfalls in Ansätzen gelingen, solange dieses Leben, wie auch die Arbeit und die Politik, nicht aus dem Bannkreis der Kapitalverwertungsdynamik gelöst und demokratisiert werden. Zu Dylan gehört daher auch das offene Eingeständnis des vorläufigen Scheiterns dieser Ansprüche. Gerade das macht bis heute einen Teil seiner Lebendigkeit aus.
In jedem Fall lässt sich Dylans Zugang zur Welt nicht so einfach für eine linke Emanzipationserzählung in Dienst nehmen. Eher schon ist er eine Übergangsfigur, die, besonders zu Beginn, im Kontext der befreiungstheologisch inspirierten Bürgerrechtsbewegung, noch Elemente eines charismatischen Messianismus aufweist. Die Erlöserrolle dekonstruiert Dylan zwar, übersetzt sie in menschliche Gestalten und löst sie in die Identitätsbastelarbeit der Popkultur auf. Aber er fällt, dem Stand des historischen Bewusstseins entsprechend, auch teilweise in Schicksalsgläubigkeit und latent bis offen religiöse Demut zurück, wenn man so will also in traditionelle Versuche einer ideologischen »Versöhnung« der durchlebten Gegensätze.xiii
Bei aller Vitalität, Ironie und Spielfreude waren Dylans Lieder von Beginn an durchzogen von düsteren Visionen. Der erste Song, der 1962 wie Donnerhall in den Boheme-Clubs des Greenwich Village erklang und den sein vielleicht wichtigster Mentor Dave Van Ronk rückblickend als Beginn der Revolte bezeichnet hat, »A Hard Rain’s A-Gonna Fall«, malt wie in einer Traumsequenz eine apokalyptische Szenerie aus und endet mit dem Bekenntnis, von diesem Inferno zu berichten.
And I’ll tell it and think it and speak it and breathe it
And reflect it from the mountain so all souls can see it
Then I’ll stand on the ocean until I start sinkin‘
But I‘ll know my song well before I start singin‘
Das markiert den einen Pol. Den anderen formuliert Dylan am Ende des offenen Briefes, den er im Nachgang des angesprochenen Eklats bei der Verleihung des Tom-Paine-Award an seine linken Kritiker richtet:
[…] out! out! brief candle
life’s an open window
an‘ I must jump back out thru it now.
Die Zeilen spielen auf einen anderen Wortkünstler an, der ähnlich geringe Berührungsängste gegenüber dem vulgären Volk hatte.
[…] out! out! brief candle
Life’s but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
Wie diese Rede aus Shakespeares Macbeth behauptete auch Dylan 1965 auf die bohrenden Fragen der JournalistInnen hin: »It’s just words and sound. It means nothin‘.« Aber die Pointe dieser ernüchternden Sätze, in denen sich die Empfindung der Ohnmacht des Dichters im Angesicht von so viel Verwirrung und Leid ausdrückt, ist, dass die Worte und Klänge nie nur eines bedeuten, auch nie nur das, was der Autor in ihnen sehen mag. Es liegt an uns, dem Kunstwerk – und mit seiner Hilfe dem Leben selbst – Bedeutung, Hoffnung und Dauer zu geben, es zu erkennen als Teil eines großen Überlieferungsgeschehens, das mit den bürgerlichen Vorstellungen von geistiger Urheberschaft und individuellem Schöpfertum unvereinbar ist. Und wenn es uns als politischen Akteuren bisher auch schwerfallen mag, eine solche Poesie des Lebens und der alltäglichen Kämpfe in unsere kollektiven Erzählungen und Organisierungsprojekte zu integrieren, so sollten wir uns doch wenigstens als empfindsame Einzelne daran erinnern, wie reich der vor uns liegende Fundus der Geschichte ist. Gerade in Zeiten wie diesen ist das ein ermutigender Gedanke.
Yes, I am a thief of thoughts
Not, I pray, a stealer of souls
I have built an’ rebuilt
Upon what is waitin’
For the sand of the beaches
Carves many castles
On what has been opened
Before my time
A word, a tune, a story, a line
Keys in the wind t’ unlock my mind
An’ t’ grant my closet thoughts backyard airxiv
Ein Beitrag von Max Lill, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt Universität Berlin.
Der Artikel erschien in der Sozialismus-Ausgabe 12/2016. Die Zeitschrift ist ein Forum für die politische Debatte der gewerkschaftlichen und politischen Linken. (Probe-)Abonnements können auf www.sozialismus.de abgeschlossen werden.
i Für eine ausführlichere Diskussion der zeithistorischen und geschichtspolitischen Bedeutung von Dylans Frühwerk vgl. auch Max Lill: The whole wide world is watchin‘. Musik und Jugendprotest in den 1960er Jahren. Bob Dylan und The Grateful Dead, Berlin 2013.
ii Vgl. hierzu etwa die kritischen Kommentare von DW-Kulturredakteur Stefan Dege und – aus der Perspektive der Popkritik – Tobias Rüther in der FAZ vom 17.10.2016 (beide online verfügbar). Zustimmend dagegen Lothar Müller in der SZ vom 14.10.2016.
iii Danius begründete die Entscheidung auf Nachfragen hin explizit mit der Erinnerung daran, dass auch die Ilias, also einer der Urgründe abendländischer Erzähltraditionen, aus einer mündlichen und oft in Liedform vorgetragenen Überlieferungsgeschichte hervorgegangen sei. Die Öffnung hin zu einem erweiterten Literaturbegriff hatte sich schon im Vorjahr mit der Ehrung von Swetlana Alexijewitsch angedeutet. Eine Parallele zu Dylan mag man darin sehen, dass auch ihre dokumentarisch geprägte Prosa ein von Zeitgeschichte gesättigtes Mosaik heterogener Stimmen und Schicksale darstellt (vgl. Steinfeld in der SZ vom 14.10.2016, S. 11).
iv Auch Leonard Cohen, der, wie er einmal sagte, ursprünglich Schriftsteller sein wollte und erst nach der Erfahrung mit Dylan entschied, Songwriter und Entertainer zu werden, ließ sich vom Sterbebett aus mit der Aussage zitieren: Die Entscheidung, Dylan den Literaturnobelpreis zu verleihen, sei vergleichbar mit der Aufstellung eines Schildes am Fuße des Mount Everest, das darüber informiert, es handele sich um den höchsten Berg der Welt.
v Heinrich Detering, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der zu jenen gehört, die unermüdlich daran mitgearbeitet haben, die Preiswürdigkeit des Geehrten herauszustreichen, wies in diesem Sinne wiederholt darauf hin, dass Dylan den Nobelpreis nicht wirklich brauche, der Nobelpreis aber womöglich Dylan.
vi Diese Selbstbeschreibung verwendete Dylan auf einer Pressekonferenz des Jahres 1965.
vii Es lässt sich spekulieren, ob Dylans – vielfach als arrogant kritisierte – späte Reaktion auf die Ehrung und das vom ihm angekündigte Fernbleiben bei der Verleihungszeremonie am 10.12.2016 seine Distanz gegenüber den Institutionen des literarischen Feldes und ihren Regeln symbolischer Anerkennung zum Ausdruck bringen sollen – oder ob sie lediglich Dylans berüchtigter Abneigung gegenüber Preisverleihungen und öffentlicher Rede geschuldet sind.
viii Zitiert nach Antonio Gramsci: Literatur und Kultur, herausgegeben von Ingo Lauggas, Argument Verlag 2012, S. 27-28.
ix Vgl. hierzu die umfangreiche musikwissenschaftliche Analyse von Richard Klein: My Name It Is Nothin‘: Bob Dylan – Nicht Kunst, nicht Pop, Berlin 2006.
x Axel Honneth ist Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Sein Kommentar erschien in der ZEIT vom 20.10.2016, S. 50.
xi Vgl. Robert Shelton: Bob Dylan. No Direction Home – Sein Leben, seine Musik 1941-1978, Hamburg 2011.
xii Es verrät einiges über den Gang der historischen Entwicklung, dass gerade dieser nihilistische Dylan heute von vielen Fans als Inbegriff von Coolness idealisiert wird. Der Kultstatus des Films Dont Look Back von D.A. Pennebaker ist hierfür ein gutes Beispiel.
xiii Abgesehen von der Gospelphase 1979-1981 bleiben Transzendenzbezüge bei Dylan allerdings ambivalent und vielfach ironisch gebrochen. Eine Szene, die das schön auf den Punkt bringt, stammt aus dem Filmmaterial zur Rolling Thunder-Tour, mit der Dylan 1975 – kreideweiß maskiert – in die Öffentlichkeit zurückkehrte. Allen Ginsberg erinnerte sich später, wie er mit Dylan nahe der Grabstätte von Jack Kerouac am Fuße einer großen Jesus-Statue gestanden und herumgealbert hatte: Was man für so einen wohl noch tun könne, habe Dylan spöttisch gefragt – er, der es, anders als Christus, ja vermieden hatte, auf die Rolle des Messias »festgenagelt« zu werden. »Es war, als ob Dylan scherzhaft mit dem furchtbaren Potential seiner eigenen mythologischen Bildhaftigkeit spielt, ohne Angst und bereit, sich mit all dem zu konfrontieren und vernünftig damit umzugehen. Das schien mir das Charakteristische an der ganzen Tour zu sein […].« (zitiert nach Shelton a.a.O., S. 609).
xiv Auszug aus den 11 Outlined Epitaphs, dem Covertext zum 1963er-Album The Times They Are A-Changin‘, auf dessen Titelsong auch die Überschrift dieses Beitrages anspielt.
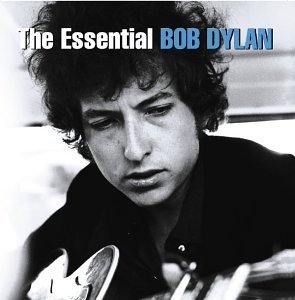








Eine Antwort
Wer ist denn hier der Autor, Lill oder Jamal, oder handelt es sich ume ine von Jamal bearbeitete Version des Textes von Lill?